Gottgleich – Marcus Antonius und der Neo-Dionysos-Kult

Darstellung des Bacchus zusammen
mit Silenus,
Fresko aus Boscoreale, ca. 30 v.Chr.,
British Museum, Inv. Nr. 1899,0215.1.
Der religiöse Kult um den Gott Dionysos, lat. Bacchus, soll seinen Ursprung im Osten gehabt haben und sich von dort aus erst über den griechischen Raum und dann über das ganze Römische Reich ausgebreitet haben. Bereits der Dichter Euripides beschreibt Dionysos in seinem Theaterstück „Die Bakchen"als friedlichen Eroberer, nachdem er seinen Kult auf friedliche Art und Weise von Theben bis nach Indien, das Ende der damals bekannten Welt, verbreitet hatte. Diese Vorstellung einer integrativen Invasion und Zivilisierung des Ostens durch den Gott Dionysos nutzten einige Herrscher auch für ihre eigenen Zwecke. Einer der ersten und berühmtesten Herrscher, der sich in Verbindung mit dem Gott Dionysos dargestellt hat, war Alexander der Große. Er nutzte den Kult, um sich die Unterstützung der Bevölkerung im Osten zu sichern. Als Nachfolger Alexanders stellten viele hellenistische Herrscher sich zusammen mit dem Gott des Weines und der Ektase da. Diese Form der Nachahmung bezeichnet die Forschung als imitatio Alexandri. Auch die hellenistischen Könige nutzten den Kult als Form der Akzeptanzpolitik bei der lokalen Bevölkerung sowie als Legitimationsnachweis ihrer Herrschaft und Betonung ihrer göttlichen Abstammung. Unter der Herrschaft des Ptolemaios II. Philadelphos fanden in Alexandria einige religiöse Prozessionen statt, die den Dionysos-Kult in den Mittelpunkt der hellenisch-ägyptischen Gesellschaft stellten. Der Vater von Kleopatra, Ptolemaios XII., ging sogar noch weiter und übernahm den Beinamen Neos Dionysos (gr. Νέος Διόνυσος). Diese Selbstbezeichnung sollte seine göttliche Legitimation und seine Nähe zu Dionysos betonen.
Dieser Tradition folgt auch Marcus Antonius, als er nach dem Tod Caesars die Bindung der östlichen Provinzen an das Römische Reich sicherte. Hierbei betonte er vor allem den friedlichen, integrativen Charakter des Gottes. Somit knüpfte er nicht nur an die lokalen östlichen religiösen Praktiken an, sondern inszenierte sich in klarer Linie zu den hellenistischen Königen, um seine Rolle als integrativer Eroberer zu legitimieren. Darüber hinaus war die Betonung seiner friedlichen Absichten, nicht seine Fähigkeiten als Feldherr, ein essenzieller Part für die Selbstdarstellung des Antonius, denn in Asien waren die Römer wegen der Steuerausbeutung sehr unbeliebt.
Laut dem griechischen Schriftsteller Plutarch soll Marcus Antonius sogar wie der Gott Dionysos selbst in Ephesos eingezogen sein.
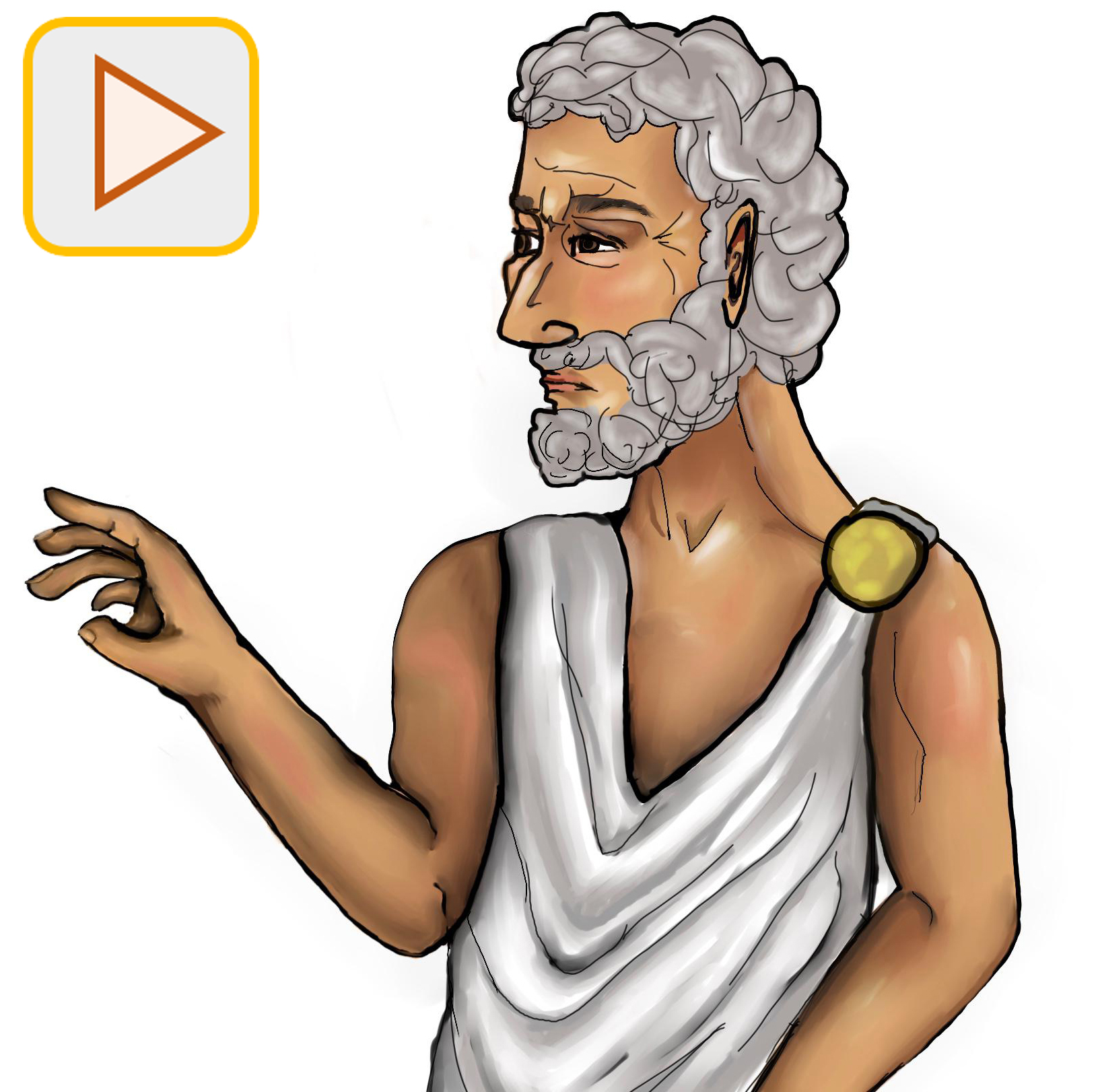
Zeichnung von Plutarch
Zeichnung von Vanessa Fernbach
Als er in Ephesos einzog, gingen Frauen als Bakchantinnen, Männer und Knaben als Satyrn und Pane kostümiert vor ihm her, von Efeu und Thyrsosstäben, vom Klang von Saiteninstrumenten, voll Schalmeinen und Flöten war die Stadt erfüllt, und ihn selber priesen sie als Dionysos den Freudenbringer, den Huldreichen. Das war gewiss für einige […]
- Plut. Ant. 24 (Übersetzung von K. Ziegler)
Diese Selbstinszenierung nutze Antonius bereits vor seiner Heirat mit Octavia und vor seiner Begegnung mit Kleopatra. Dies verdeutlicht, dass Antonius eine eigenständige Strategie verfolgte, um politische Spannungen abzubauen und seine Herrschaft im Osten zu stabilisieren, ohne bereits durch persönliche Bindungen beeinflusst worden zu sein.
Tiana Rutz, 6. B.A.-Semester, Universität Heidelberg