Charakterwandel des Marcus Antonius oder berechnende Propaganda?
Marcus Antonius Beziehung mit Kleopatra wird in den meisten antiken Schriften sehr negativ beschrieben. Dabei scheinen die antiken Autoren einem bestimmten Narrativ (Erzählungsmuster) zu folgen, bei dem die „romfeindliche“ Kleopatra den „braven“ römischen Bürger Marcus Antonius verführt, ihn „verdirbt“ und von Rom entfremdet. Die bekanntesten antiken Autoren, die dieser „Anti-Antonius-Propaganda“ folgen, sind Cassius Dio und Plutarch. Ganz nach dem Prinzip, der Sieger schreibt die Geschichte, ist die Geschichtsschreibung bemüht, Octavian, den späteren Kaiser Augustus und Gegner von Antonius, im besten Licht darzustellen. Neben der Hervorhebung Octavians als guter Herrscher diente die „Anti-Antonius-Propaganda“ vor allem dazu, den späteren Krieg gegen das Ptolemäerreich zu legitimieren und es nicht als Bürgerkrieg zwischen zwei römischen Feldherren wirken zu lassen.
Trotzdem erweckt Antonius nach dem heutigen Forschungsstand nicht den Anschein, Kleopatra Hals über Kopf verfallen zu sein. Nach dem Kennenlernen von Kleopatra im Jahr 41 v. Chr. und der Geburt der gemeinsamen Zwillinge im Jahr drauf, scheint Marcus Antonius nach der Hochzeit mit Octavia 40 v. Chr. für drei Jahre keinen direkten Kontakt mit der Königin von Ägypten gehabt zu haben. In Athen verweilend, beschäftigte er sich in dieser Zeit aktiv mit der Bindung des Ostens an das Römische Reich, um dieses zu stabilisieren. Man kann mit gewisser Sicherheit sagen, dass in dieser Zeit sein politisches Kalkül gegenüber jeglicher Verliebtheit, wenn man überhaupt davon sprechen kann, überwog.
Ab 37 v. Chr. ändert sich die Lage drastisch. Marcus Antonius wendet sich mehr und mehr vom Römischen Reich ab. Seine Handlungen sind verbunden mit längeren Aufenthalten in Alexandria sowie dem gemeinsamen Vorgehen mit der Hilfe Kleopatras gegen Feinde des Römischen Reiches, wie z. B. das Partherreich.
Der römischen Autor Cassius Dio geht in seinem Werk zur Römischen Geschichte auf den Charakterwandel des Marcus Antonius genauer ein. Er bedient sich hierbei dem in Rom weit verbreiteten Kulturrassismus sowie diversen Stereotypen und skizziert ein bei den Römern beliebtes Vorurteil des „schwelgerischen“ Lebens der Griechen und vor allem der Alexandriner.
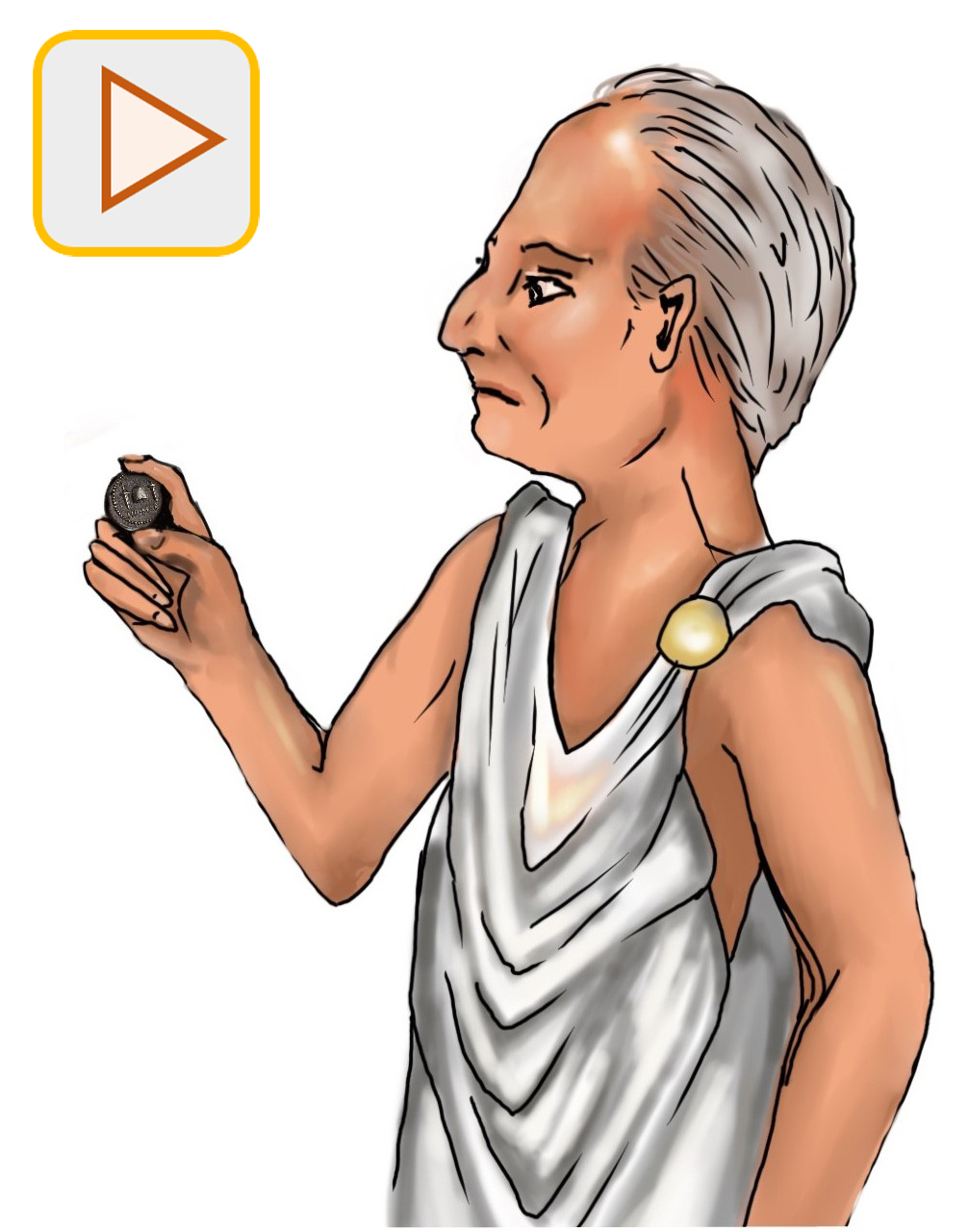
Illustration des Cassius Dio
von Vanessa Fernbach
Als er [Antonius] aber an die Macht kam, kümmerte er sich nicht mehr gewissenhaft um eines von derlei Dingen, gab sich vielmehr zusammen mit Kleopatra und den übrigen Ägyptern einem schwelgerischen Leben hin, bis er jeden sittlichen Halt verlor.
– Cass. Dio XLVIII 27,2 (Übersetzung von O. Veh)
Was nun der Auslöser für den von Cassius Dio skizzierten Sinneswandel des römischen Feldherrn war, ist unklar und wird vermutlich auch in der zukünftigen Forschung nicht eindeutig beantwortet werden können. Doch eins ist klar, es war eine drastische Entwicklung, die, beflügelt durch die antialexandrinische Propaganda Octavians, letztlich das Ende des Antonius besiegelte.
Paula Niekisch, 1. B.A.-Semester, Universität Heidelberg